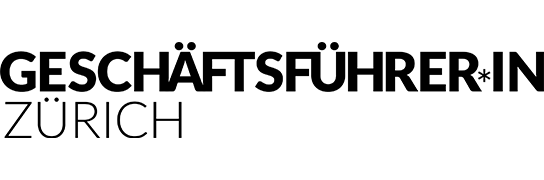Seit diesem Jahr geht die Schaffhauser Uhrenmanufaktur IWC mit einem eigenen Rennstall bei historischen Motorsport-Events an den Start. An der Arosa Classic Car startete der Ex-Formel-1-Pilot Karl Wendlinger im Cockpit eines Mercedes 300 SL Flügeltürer für IWC.
IWC ist als Partner längst schon Bestandteil der aktuellen Motorsport-Szene. Seit diesem Jahr nun sogar mit einem eigenen Rennteam im historischen Motorsport, der seit drei Jahren eine weitere wichtige Säule im Engagement von IWC bildet. Beim Goodwood Members Meeting im März trat das IWC Racing Team erstmals mit einem Mercedes-Benz 300 SL an. Präzision, Engagement, Leidenschaft – die Parallelen zwischen Uhrmacherkunst und Motorsporttechnik sind unübersehbar. Und ebenso einleuchtend wie die Wahl eines der legendären Flügeltürer. Der Mercedes-Benz 300 SL steht wie kaum ein anderes klassisches Automobil für innovative Technik, zeitlos gutes Design und höchste Qualität bis ins Detail. Als Partner des Teams treten ausserdem Mercedes-AMG, Santoni, das Mercedes-Benz Classic Center und Laureus Sport for Good auf. Für das Cockpit konnte IWC zahlreiche Motorsport-Legenden wie David Coulthard, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Maro Engel, Jochen Mass und Carmen Jordá verpflichten. Und: Karl Wendlinger. Der Österreicher liess es sich nicht nehmen, an der diesjährigen Arosa Classic Car den Mercedes-Flügeltürer des IWC Racing Team zu pilotieren. Als ehemaliger Formel-1- und DTM-Fahrer hat Wendlinger über sein Engagement bei Mercedes-AMG längst auch Erfahrungen im historischen Rennsport gesammelt. Dennoch war das Bergrennen von Langwies nach Arosa über 7.8 Kilometer mit 76 Kurven und 422 Meter Höhenunterschied für ihn eine Premiere, wie er im Interview verrät.
«Geschäftsführer»: Denken Sie an den Wert des Flügeltürers, wenn Sie hier am Bergrennen teilnehmen?
Karl Wendlinger: Nein. Aber ich habe im Hinterkopf, dass es ein Bergrennen ist. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein. Mit einem Flügeltürer läge das auch nicht drin – der Altersunterschied zu den neueren Fahrzeugen ist viel zu gross. Und die Bedingungen mit Nässe und Regen sind schwierig. Ich möchte hier heute das Auto präsentieren, aber nicht Rekorde aufstellen.
Ist es dennoch eine Herausforderung?
Bergrennen sind immer eine Herausforderung. Ich bin heute das erste Mal hier: Die Strecke ist sehr lang, über sieben Kilometer, da reichen ein paar Trainingsläufe nicht aus, um sie komplett kennenzulernen.
Haben Sie noch eine Verbindung zum Rennsport, oder ist der Auftritt vor allem Reminiszenz an die Vergangenheit?
Nein, mit meiner täglichen Arbeit hat das hier nichts zu tun. Ich bin für Mercedes-AMG als Markenbotschafter, Instruktor in der AMG Driving Academy und bei Klassik-Veranstaltungen tätig. Manchmal kommen auch noch Testfahrten mit neu entwickelten Rennwagen hinzu. Hinter diesem Steuer sitze ich heute auf Einladung von IWC. IWC ist ja schon lange Partner von Mercedes-AMG, da mache ich sehr gerne eine Ausnahme und bin hier nochmals im Rennsport dabei.
Haben Sie auch selbst einen Klassiker?
Nein, im Moment nicht. Hätte ich mal gerne, aber das hat noch Zeit. Da ich seit 2012 bei Mercedes-AMG auch immer wieder den Bezug zur Klassik habe. Mille Miglia, Goodwood Festival of Speed, Revival oder Members Meeting, Silvretta Klassik – ist ja kein Rennsport auf Zeit, sondern auf Genauigkeit, auf Präzision beim Fahren.
Bedauern Sie, dass Ihre Motorsport-Zeit vorbei ist?
Nein. Eine Zeit lang habe ich noch gedacht, es würde mich beschäftigen, wenn ich keine Rennen mehr fahren kann. Aber das ist jetzt vorbei.
Hatten Sie Entzugserscheinungen?
Eigentlich nicht. Solange ich wirklich Rennen fahren wollte, konnte ich das auch. Aber inzwischen ist mir meine Arbeit bei Mercedes-AMG wichtiger. Halbe Sachen liegen mir nicht, entweder mache ich etwas mit vollem Engagement – oder lasse es bleiben. Ich will mich voll auf eins konzentrieren können.
Sonst kann man auch nicht «up to date» bleiben, oder?
Genau. Die GT-Klassen, GT3, GT4 könnte ich parallel zur Tätigkeit bei Mercedes-AMG durchaus fahren. Aber die Starterfelder sind so gut besetzt: Viele junge Fahrer kommen im Formel-Sport nicht weiter und wechseln dann in eine GT-Klasse. Und sind richtig schnell. Schon drei, vier Zehntelsekunden pro Runde machen am Ende zwischen 10 und 15 Startplätze aus. Mit «ein bisschen und nebenbei» kann man da nicht mithalten.
War es anfangs Ihrer Karriere Ende der 1980er leichter, in den Motorsport einzusteigen?
Nein, ich glaube nicht. Im Jahr 1989 hatten wir ein «deutsches» Formel-3-Jahr – Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen und Michael Bartels sind gefahren, und ich dann auch. Leichter machte es die grössere Zahl an Autos in der Formel 1. Aber bei der Hälfte der Teams hat der Fahrer sich selbst finanziert, und für einen Österreicher waren gute Sponsoren im Land einfach nicht vorhanden. Und es gab keine Nachwuchsförderung wie heute. Früher war es schwierig, heute ist es schwierig – es gibt ja nur 20 Formel-1-Autos.
Wie war es früher bei Sauber?
Die Atmosphäre bei Sauber war gut. Ende 1989 sind Schumacher, Frentzen und ich ins Mercedes Junior-Team gekommen und haben erste Testfahrten Gruppe C gemacht. 1991 bin ich dann ein komplettes Jahr Gruppe C gefahren zusammen mit Schumacher auf einem Auto. 1992 dann Vorbereitung auf die Formel 1 bei Sauber-Mercedes und 1993 die ersten Rennen. 1994 hatte ich meinen Unfall in Monaco und war nicht mehr dabei. Damals war Sauber ein kleines Team mit 110 Mitarbeitern. Und jetzt hat es als Mittelklasse-Team schon 450 Leute. Die Grössenordnungen haben sich in der Formel 1 massiv verändert.
Wie haben Sie Ihren Unfall in Monaco 1994 verarbeitet?
Er hat mich verändert. Vor dem Unfall habe ich nicht geredet, danach habe ich viel geredet und heute bin ich wieder ruhiger. Nein, der Unfall hat mich geprägt. Man spürt es nur selbst nicht, weil man wieder in den Alltag zurückkehrt und auch den Motorsport-Traum weiterverfolgt.
Und dann ging es in die DTM.
Ab 1995 habe ich die ersten Tourenwagen-Rennen gefahren; 1996 / 1997 war ich dann bei Audi als Werkfahrer und danach dann lange im GT-Sport.
Was war der grössere Schritt: Formel 3 zur Formel 1 oder Formel 1 zur DTM?
Formel 3 auf Formel 1 wäre ein grosser Schritt gewesen. Ich hatte das Glück, dazwischen noch Gruppe C fahren zu können mit hohen Tempi und viel Abtrieb. Aber von der Formel 1 zurück in den Zweiliter-Tourenwagen war es viel schwieriger. DTM-Autos hatten viel Gewicht, aber wenig Leistung. Im Formel-Sport fährt man Fehler mit viel Gas wieder heraus. Wenn ich im Tourenwagen eine Zehntelsekunde zu spät am Gas war, war das gleich ein grosser Zeitverlust.
Was war die beste Zeit – Sturm und Drang oder die Zeit als erfahrener Fahrer?
Die gute Zeit war sicher die in Gruppe C und Formel 1 und Ende der 1990er-Jahre meine Zeit im Chrysler-Viper-Team: Da haben wir viel gewonnen, zum Beispiel die 24 Stunden von Daytona. Und dann 2007/2008 im österreichischen Jetalliance-Team in der GT-Klasse. Keine Weltmeisterschaft, aber eine gut besetzte Serie. In der Formel 3 war es Sturm und Drang – nicht nachdenken, sondern einfach zum Rennen kommen und dann irgendwie fahren.
Ist es ein Problem, wenn man beim Rennen nachdenkt? Oder hilft es eher?
Man braucht eine gute Mischung aus Denken und Intuition. Früher, ohne Erfahrung, habe ich nicht nachgedacht, aber konnte dann auch unbedarft ins Rennen gehen. Später hat die Erfahrung in bestimmten Situationen schon geholfen. Aber zu viel Denken bremst dann aus. Man muss nicht alles immer intellektuell hinterfragen.
Früher waren Fahrer Helden, später wurden das Team und die Regeln wichtiger. Haben Sie von diesem Umbruch etwas mitbekommen?
Ich bin erst nach dem Umbruch dazugekommen. Ab 1990 bei Mercedes gab es technische Besprechungen, das war damals etwas Neues für uns. Es gab auch bis 1991 noch keine Telemetrie. Vorher hat man einfach nach Gefühl das Auto abgestimmt. Ab 1993 wurde die Vorbereitung des Autos technisch fundierter, aber es war noch immer Oldschoool-Motorsport, bei dem man mit dem Rennmechaniker in der Box entschieden hat, ob der Dämpfer härter oder weicher sein sollte. Heutige Formel-1-Fahrer entscheiden immer noch vieles mit, doch die Computersimulation nimmt viel Einfluss. Damit muss ein Fahrer dann zurechtkommen.
Schmälert Technik das fahrerische Können?
Nein. Heute ist es deutlich schneller, deutlich anspruchsvoller von den Geschwindigkeiten her als zu meiner Zeit. Als ich 1993 in Monaco fuhr, lag Alain Prost im Williams-Renault bei einer Rundenzeit von 1:20,8. Jetzt fahren sie in Monaco die Runde fast zehn Sekunden schneller, obwohl das Reglement schon unzählige Mal die Autos verlangsamt hat. Um solch ein Auto am Limit zu bewegen, muss man ein guter Fahrer sein.
Aber reizt es Sie nicht doch noch, wenn Sie Formel 1 im Fernsehen verfolgen?
Nein – es ginge auch nicht mehr. Ich hätte weder die Kondition, noch die Kraft. Zu meiner Zeit waren wir schon fit, aber eben nicht so wie heute. Wir haben zum Beispiel nie wissenschaftlich fundiertes Konditionstraining betrieben. Ich habe meine Übungen gemacht, jeden Tag, stundenlang, aber manchmal wäre eine Ruhephase sicher besser gewesen. Niki Lauda hat mir dagegen mal gesagt, er hätte sein Leben lang keine Turnschuhe besessen. Aber zu seiner Zeit war Fitness halt bei allen Fahrern kaum ein Thema.
Ist Lauda ein Vorbild?
Sicher, aber zu meiner aktiven Zeit war es vor allem Ayrton Senna. Man hat schon an seinem Auftritt im Fahrerlager gespürt: Der kommt aus einer anderen Klasse. Aber er war für mich zu weit weg.